Das Erinnern mit Computerspielen lebendig halten
Gastbeitrag der Stiftung Digitale Spielekultur
Immer mehr erinnerungskulturelle Einrichtungen entdecken Games als Türöffner und Wissens-Container für die Geschichte des Nationalsozialismus. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz sogenannter Serious Games, sondern auch um eine generelle Sensibilisierung für die Besonderheiten und Potenziale interaktiver Darstellungen in der historischen Bildungs- und Vermittlungsarbeit.
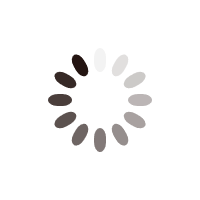
Viele Menschen, darunter insbesondere Kinder und Jugendliche, kommen heute vorrangig über digitale Medien in Kontakt mit der Vergangenheit bzw. Inszenierungen davon. Neben Social Media gehören dazu seit geraumer Zeit auch digitale Spiele. Wie in vielen anderen populären Medien und Künsten, ist der Zweite Weltkrieg in Computerspielen ein regelmäßig anzutreffendes Szenario, dessen mediatisierte Darstellung aber oft wichtige Aspekte – insbesondere des NS-Unrechts - ausblendet oder verkürzt darstellt. Gleichzeitig können diese Darstellungen besonders eindrücklich sein, da sie im übertragenden Sinne eine direkte Interaktion mit der Vergangenheit und das Einnehmen fremder Perspektiven durch die Augen der Spielfiguren ermöglichen. Durch das Verschwinden der letzte Zeitzeug*innen werden in diesen Tagen gleichzeitig die realen Verbrechen des Nationalsozialismus von gelebter Erinnerung zu archivierter Geschichte. Sowohl das Gedenken an die Opfer des NS-Unrechts als auch der gegenwärtige Kampf gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, LGBTQ+-Feindlichkeit und weitere Formen gruppenbezogener Diskriminierung steht damit vor der Herausforderung, das Erinnern für neue Generationen lebendig zu halten.
Hier knüpft die Idee einer digitalen Erinnerungskultur mit Hilfe digitaler Spiele an, die die Stiftung Digitale Spielekultur im Rahmen des Projekts „Let’s Remember! Erinnerungskultur mit Games vor Ort“ einem Praxistest unterzogen hat. Einerseits hat das Vorhaben veranschaulicht, dass sich bestimmte Games bereits auf sensible Weise mit NS-Geschichte auseinandersetzen und sich dementsprechend auch für den Einsatz in der Vermittlungsarbeit eignen. Anderseits hat das Projekt in Kooperation mit Einrichtungen aus ganz Deutschland pädagogische Fachkräfte für Geschichtsdarstellungen und ihre Leerstellen in populären Spielen sensibilisiert. Inzwischen hat eine Reihe von Gedenkstätten und Erinnerungsorten die Potenziale digitaler Spiele für ihre eigene Arbeit erkannt und selbst Spiele in Auftrag gegeben, die den Besuch der jeweiligen Orte gezielt ergänzen sollen. Beispiele sind die Titel „Forced Abroad“ des NS-Dokumentationszentrums München, „Spuren auf Paper“ der Gedenkstätte Wehnen und „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“ von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte.

Das Themenportal Games – Erinnerung – Kultur der Stiftung Digitale Spielekultur versammelt verschiedene Texte, Medieninhalte und Materialien zur Einführung, Vertiefung und Erprobung von digitalen Spielen in der erinnerungskulturellen Arbeit. Es richtet sich insbesondere an pädagogische Fachkräfte und interessierte Mitarbeiter*innen aus Gedenkstätten, Museen und Bildungssorten zum NS-Unrecht. Teil des Informationsangebots ist auch die Datenbank: Games und Erinnerungskultur, eine von Geisteswissenschaftler*innen kuratierte Übersicht von Games, die von besonderer erinnerungskultureller Relevanz sind. Das „Let’s Remember!“-Projekt wurde von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) sowie vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Rahmen der Bildungsagenda NS-Unrecht gefördert.

