Corporate Learning: Ohne Motivation hilft auch keine KI
Gastbeitrag von Scheer IMC zum Lerntechnologienreport 2025
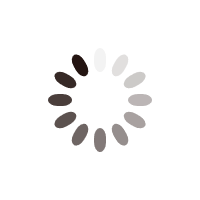
- Motivation ist der entscheidende Erfolgsfaktor für Corporate Learning: Fast jede zweite Führungskraft sieht fehlendes Engagement der Mitarbeitenden als größte Hürde für wirksame Weiterbildung, unabhängig von den eingesetzten Technologien.
- Künstliche Intelligenz kann Lernen personalisieren, ersetzt aber keine intrinsische Motivation: KI-gestützte Tools sind bereits etabliert und werden weiter ausgebaut, doch nachhaltiges Lernen gelingt nur, wenn Unternehmen eine motivierende Lernkultur schaffen.
- Lernangebote müssen persönlichen Nutzen und Relevanz vermitteln: Nur wenn Mitarbeitende den individuellen Mehrwert erkennen und Lernen als selbstverständlichen Teil des Arbeitsalltags erleben, entfalten digitale Trainings und neue Technologien ihr Potenzial.
Fast jede zweite Führungskraft kämpft damit, Mitarbeitende dauerhaft fürs Lernen zu begeistern. Was steckt dahinter und wie lässt sich das ändern?
Ob Compliance-Schulung oder IT-Sicherheitskurs: Viele Beschäftigte haken digitale Trainings ab, ohne wirklich etwas mitzunehmen. Neugier bleibt aus, stattdessen zählt das schnelle Durchklicken. Doch der Druck auf Unternehmen steigt. Neue Technologien entwickeln sich rasant und Märkte verändern sich fast täglich. Wer Schritt halten will, muss dafür sorgen, dass notwendiges Wissen nicht nur bereitsteht, sondern auch ankommt.
Ein Blick in den Lerntechnologie-Report 2025 zeigt: in vielen Unternehmen gelingt es noch nicht, Mitarbeitende fürs Lernen zu begeistern. Scheer IMC und die unabhängige Forschungsgesellschaft „Research Without Barriers“ haben 365 Führungskräfte befragt, die für betriebliche Weiterbildung in Organisationen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden verantwortlich sind. Fast jeder zweite (47 Prozent) sieht fehlendes Engagement der Lernenden als größte Hürde. „Mit der Motivation beim Lernen ist es wie in der Logik eines Programmcodes: Sie kennt nur zwei Zustände, 1 oder 0, entweder sie springt an oder sie bleibt aus“, sagt Sven R. Becker, Co-CEO der Scheer IMC. Besonders bei Mitarbeitenden ohne Büroarbeitsplatz, etwa in der Produktion oder Logistik, sei es schwer, Begeisterung fürs Lernen zu wecken. In solchen Umfeldern könnten Unternehmen auf ergänzende Formate setzen, etwa Kolleginnen und Kollegen, die als Lernbegleiter aktiv durchs Unternehmen gehen und Wissen vermitteln. Wissensarbeiter zeigen zwar häufiger Eigeninitiative in Sachen Weiterbildung, doch auch bei ihnen ist Motivation kein Selbstläufer. Wer eine wirksame Lernkultur etablieren will, muss über Zielgruppen, Formate und Zugänge neu nachdenken.
Motivation schlägt Technik
Für mehr als zwei Drittel der Befragten steht fest: Künstliche Intelligenz (KI) wird das Lernen in den nächsten drei Jahren maßgeblich prägen. 25 Prozent planen Investitionen in KI-gestützte Autorentools, was Becker als Vorstand eines Full-Service-Anbieters von E-Learning Technologien schmunzelnd einordnet: „Die anderen 75 Prozent haben vermutlich bereits in KI-Technologien investiert.“ Nach seiner Erfahrung sind vor allem in größeren Unternehmen KI-gestützte Systeme, etwa zur Content-Erstellung, fester Bestandteil der Weiterbildungslandschaft und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Doch der Experte für Corporate Learning warnt vor einem Denkfehler: „Ohne intrinsische Motivation bringt die beste Technik nichts. Lernen beginnt im Kopf und der muss erst einmal bereit dafür sein.“ Als Beispiel wie das gelingen kann nennt er „Cyber Crime Time“, ein von Scheer IMC entwickeltes IT-Sicherheits-Training in dem Lernende die Rolle eines Hackers einnehmen: „Man könnte etwas ketzerisch sagen, da lernt man gar nichts. Doch das wie ein Computerspiel angelegte Format sensibilisiert für die Thematik. Danach wollen die Leute mehr wissen und dann beginnt das echte Lernen.“
Das Problem vieler Lernangebote sei, dass sie zu sehr auf Inhalte fokussiert sind, statt auf den persönlichen Nutzen. Becker betont: „Den Lernenden muss klar werden, was das neue Wissen ihnen persönlich bringt. Zum Beispiel: Du lernst, besser zu verkaufen und kannst dadurch mehr verdienen.“ Genau dieser individuelle Bezug fehle vielen Programmen heute noch. Hilfestellung könne das sogenannte ARCS-Modell geben. Es stammt aus der Lernforschung und beschreibt vier wichtige Schritte, um die Lernmotivation zu fördern: Zuerst muss bei der Zielgruppe Aufmerksamkeit geweckt werden (Attention), dann der persönliche Nutzen klar sein (Relevance). Außerdem brauchen Lernende das Gefühl, Erfolge zu erzielen (Confidence), und am Ende sollte das Lernen mit Zufriedenheit belohnt werden (Satisfaction). Technologien wie Gamification oder (digitale) Lernbegleiter können diese Schritte unterstützen. „Doch ohne die entsprechende Unternehmenskultur bringen die besten Tools und Hilfsmittel nichts“, betont Becker. Lernen funktioniere nur, wenn es im Unternehmen wirklich gewollt und gelebt wird. Nicht als Pflichtprogramm, sondern als selbstverständlicher Teil des Arbeitsalltags. „Unternehmen müssen bereit sein, ihre Haltung zum Lernen zu verändern, Führungskräfte einbinden und den Mitarbeitenden Zeit und Raum geben. Es braucht eine Kultur, in der Lernen nicht nur möglich, sondern auch gewünscht ist“, führt Becker weiter aus. Andernfalls blieben moderne Technologien oft ungenutzt.
KI: Gamechanger und Risiko
Auch wegen ihrer Fähigkeit zur Personalisierung wird Künstliche Intelligenz die Zukunft des betrieblichen Lernens prägen. Denn KI kann nicht nur Lerninhalte aus einem Word-Dokument automatisch in Text, Video oder Audioformat überführen. Sie kann auch Lerntypen analysieren, Kontext erfassen und Inhalte zur richtigen Zeit im passenden Format liefern. Der gestresste Vertriebler bekommt dann etwa abends ein knackiges Video präsentiert. Die Mitarbeiterin mit festen Lernzeiten im Büro erhält ein interaktives E-Learning. Adaptivität wird zum Schlüssel: „Wenn sich Lernangebote flexibel an Bedürfnisse und Lebensumstände anpassen, kann jeder so lernen, wie es für sie oder ihn am besten passt“, erläutert Becker.
Was das Corporate Learning revolutionieren kann, birgt im Arbeitsalltag auch Risiken: „Wenn KI uns sämtliche Routineaufgaben abnimmt, wir nur noch fertige Antworten bekommen und die Lösung nicht mehr Schritt für Schritt selbst entwickeln müssen, verlernen wir das Denken“, warnt Becker. Dazu passt ein OECD Projekt: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die internationale Bildungsstandards und Zukunftskompetenzen erforscht, benennt kreatives Denken und kritisches Denken explizit als Schlüsselkompetenzen für die komplexen und globalisierten Gesellschaften und Volkswirtschaften des 21. Jahrhunderts.
Diese Kompetenz müsse sowohl in der Schule als auch im Berufsleben und darüber hinaus ständig gefördert werden. „KI kann Lernen einfacher und zugänglicher machen, doch sie sollte uns das Denken nicht komplett abnehmen. Es liegt an den Unternehmen, neue Technologien so in ihre Lernkultur einzubetten, dass sie Selbstständigkeit und Reflexion fördern. Denn nur wo Menschen selbst lernen wollen, entsteht echter Fortschritt“, resümiert der Lern- und Bildungsberater.
Bildunterschrift:
Sven R. Becker, Co-CEO der Scheer IMC: „Ohne intrinsische Motivation bringt die beste Technik nichts.“
Quelle: Scheer IMC
Quellen:
https://www.oecd.org/en/about/projects/teaching-learning-and-assessing-creative-and-critical-thinking-skills.html

